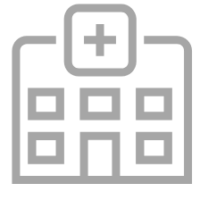Die Psychosomatik ist ein wachsendes und bedeutendes Fachgebiet, das die komplexen Wechselwirkungen zwischen Körper und Seele in den Mittelpunkt stellt. In einer Zeit, in der psychosomatische Erkrankungen zunehmen und immer mehr Menschen unter Stress, Angststörungen oder chronischen Schmerzen leiden, gewinnt diese Disziplin zunehmend an Bedeutung. Die Schwerpunktausbildung Psychosomatische und Psychosoziale Medizin bietet Ärzten in der Schweiz die Möglichkeit, sich intensiv mit den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankungen auseinanderzusetzen und innovative Therapieansätze zu erlernen.
Inhaltsverzeichnis
Das Schwerpunkt-Gebiet Psychosomatische und Psychosoziale Medizin
Die Psychosomatik und Psychosoziale Medizin ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit der Verbindung zwischen Körper und Psyche beschäftigt. In der modernen Medizin nimmt dieser Bereich eine immer wichtigere Rolle ein, da viele Erkrankungen durch psychische Belastungen beeinflusst werden und umgekehrt.
Fachärzte mit der Schwerpunktausbildung Psychosomatische und Psychosoziale Medizin arbeiten oft an der Schnittstelle zwischen somatischen und psychiatrischen Disziplinen und tragen massgeblich zu einer ganzheitlichen Patientenversorgung bei. Sie beschäftigen sich mit Krankheitsbildern, bei denen keine rein organische Ursache erkennbar ist, und unterstützen Patienten dabei, körperliche Beschwerden im Zusammenhang mit seelischen Belastungen besser zu verstehen und zu bewältigen. Sie setzen auf eine integrative Betrachtung der Patienten und berücksichtigen psychosoziale Faktoren im Rahmen der Diagnostik und Therapie. Die Behandlungsmethoden umfassen Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, körperzentrierte Verfahren sowie die Koordination mit anderen Fachdisziplinen.
Ziel ist es, sowohl die physischen als auch die psychischen Beschwerden zu lindern und langfristig die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Die Ausbildung in Psychosomatik ist somit nicht nur für die individuelle Patientenbetreuung wertvoll, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung des Gesundheitssystems insgesamt.
Typische Krankheitsbilder
Zu den häufig behandelten Krankheitsbildern gehören somatoforme Störungen, chronische Schmerzsyndrome, Angststörungen, Depressionen und stressbedingte Erkrankungen.
Auch psychosomatische Begleiterscheinungen bei chronischen Krankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen im Fokus. Häufig betreuen Ärzte auch Patienten mit Traumafolgestörungen oder psychosozialen Belastungssituationen, die sich körperlich manifestieren.
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin – Die Weiterbildung im Überblick
Die Schwerpunktausbildung für Psychosomatische und Psychosozialer Medizin ist eine strukturierte Weiterbildung, die sowohl theoretische als auch praktische Anteile umfasst. Die Weiterbildung ist modular organisiert und wird von der Schweizerischen Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin (SAPPM) koordiniert.
Voraussetzungen
Die Ausbildung im Schwerpunkt Psychosomatische und Psychosoziale Medizin steht Fachärzten aus verschiedenen Disziplinen offen. Voraussetzung ist in der Regel der Abschluss einer Facharztausbildung in einem relevanten Gebiet wie Allgemeine Innere Medizin, Psychiatrie, Neurologie oder Pädiatrie. Eine Affinität zu interdisziplinärer Arbeit und ein starkes Interesse an psychosozialen Fragestellungen sind entscheidende Faktoren für angehende Spezialisten in der Psychosomatik. Wer nicht den eidgenössischen Facharzttitel in der Schweiz erworben hat, kann einen äquivalenten ausländischen Facharzttitel anerkennen lassen.
Übersicht aller Facharztausbildungen und Fachrichtungen in der Schweiz:
Dauer
Die Schwerpunktausbildung Psychosomatische und Psychosoziale Medizin erfordert einen Gesamtzeitaufwand von 360 Stunden. Diese setzen sich aus 120 Stunden Theorie, 120 Stunden Fertigkeiten und 120 Stunden Supervision/Selbsterfahrung zusammen. Für die Bereiche Theorie und Fertigkeiten können jeweils maximal 20 Stunden als Selbststudium anerkannt werden.
Die Weiterbildung erfolgt in Weiterbildungseinheiten, die von der Akademie SAPPM (Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin) evaluiert und mit einer bestimmten Anzahl von Credits versehen werden. Die klinische Tätigkeit in psychosomatischer und psychosozialer Medizin an einer anerkannten Weiterbildungsstätte sowie spezifische Weiterbildungen im Rahmen der Facharztweiterbildung werden in Form von Credits angerechnet. Für ein Jahr Tätigkeit an einer SAPPM-evaluierten Weiterbildungsstätte mit Schwerpunkt Psychosomatische und Psychosoziale Medizin, werden pro Jahr 120 Credits (max. 240 Credits) angerechnet.
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin – Inhalt der Schwerpunkt-Ausbildung
Die Ausbildung umfasst eine breite Palette an Inhalten, die auf die Entwicklung eines umfassenden Verständnisses für psychosomatische Krankheitsbilder abzielt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Anwendung erlernter Techniken in der Patientenversorgung. Dazu gehört die Teilnahme an Konsiliar- und Liaisondiensten in Akutspitälern sowie die enge Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen.
Theorie und Kenntnisse
Ziel dieses Ausbildungsabschnitts ist der Erwerb von Kenntnissen der theoretischen Grundlagen in der Psychosomatischen und Psychosozialen Medizin mit Hilfe von Vorlesungen, Seminaren und Referaten und Literaturstudium.
Allgemeine Psychosomatik:
- Bio-psycho-soziale Modelle von Gesundheit und Krankheit (z.B. Beiträge aus der Psychoanalyse, Entwicklungspsychologie, kognitive Verhaltenstherapie, Psychophysiologie, Systemtheorie, Kommunikationslehre, Lerntheorie, Stresstheorie, Strukturmodelle der Persönlichkeit)
- Theorien und Modelle der Arzt-Patient-Beziehung (z.B. Arbeitsbündnis, Abwehrmechanismen und Widerstand)
- Theorie zum Gesundheits- und Krankheitsverhalten (z.B. Bewältigung traumatisierender und kritischer Lebensereignisse)
- Diagnostische Systeme und Klassifikationen (DSM IV, ICD 10 und andere)
- Abgrenzung zu psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlungsindikationen
Spezielle Psychosomatik:
- Psychosoziale Auswirkungen akuter und chronischer Krankheiten (z.B. chronische Schmerzen, Psychoonkologie, psychosoziale Aspekte des Herzkreislaufkranken, psychosomatische Aspekte in der Transplantationsmedizin, HIV)
- Verhaltensstörungen und psychische Störungen mit körperlichen Symptomen
- Somatische Erkrankungen bei denen psychosoziale Faktoren eine entscheidende Bedeutung bei Entstehung und Fortdauer zukommen
- Psychosoziale Problemstellungen im Zusammenhang mit den Lebensphasen
- Funktionelle somatische Symptome und Syndrome (z.B. Reizdarm, CFS, Fibromyalgie)
Fachspezifische Psychosomatik:
Nach Absprache der Akademie SAPPM mit den jeweiligen Fachgesellschaften können gewisse Lehrinhalte durch fachspezifische Psychosomatik ergänzt und/oder ersetzt werden, z. B.:
- Spezielle Psychosomatik für Pädiater
- Gesunde und gestörte Entwicklung des Kindes
- Störungen der Autonomieentwicklung
- Adoleszenten-/Ablösungskrisen
- Verdacht auf Kindsmisshandlung
- Das gesunde Kind im schwierigen sozialen Umfeld
Fertigkeiten
In diesem Ausbildungsabschnitt geht es im Wesentlichen um das Erlernen von allgemeinen und speziellen Techniken der Gesprächsführung, Wege und Verfahren zur Diagnosestellung, Behandlungstechniken (Gespräch, Entspannungsverfahren, Psychoedukation in Gruppen, Pharmakotherapie), Fähigkeit zur Gestaltung und Einhaltung angemessener Rahmenbedingungen (Praxisorganisation, Abteilungsorganisation, Zusammenarbeit, delegierte Psychotherapie) sowie das Kennenlernen eigener Grenzen. Zu diesem Zweck kommen Gruppenunterricht, Rollenspiele, Live-Gespräche, Kleingruppendiskussionen und Videoaufnahmen zum Einsatz:
- Erstgespräch, Formen der Anamnese, Beratungsgespräch, Paar- und Familiengespräch, allgemeine Prinzipien psychosomatischer Berichterstellung
- Spezifische therapeutische Interventionen (z.B. psychodynamisch, kognitivverhaltenstherapeutisch, systemisch; Krisenintervention, Langzeit- und Sterbebetreuung, Beendigung von therapeutischen Beziehungen)
- Entspannungsverfahren
- Erkennen und Fördern von Ressourcen beim Patienten und seinem Bezugssystem
Supervision und Selbsterfahrung
Die Ziele dieses Ausbildungsabschnitts sind die Umsetzung und Überprüfung von Kenntnissen und Fertigkeiten in der Praxis, die Differenzierung von Selbst- und Fremdwahrnehmung, das Erkennen von Konflikten, Defiziten und Ressourcen bei Patient und Arzt sowie die Regulierung von Nähe und Distanz in der Arzt-Patient-Beziehung.
Dazu kommen Gegenübertragungsanalysen, die Entwicklung differenzierter verbaler und averbaler Kommunikationsmöglichkeiten, die Analyse von Interaktionsabläufen und von therapeutischen Prozessen, die Selbsterfahrung in entweder analytischer, systemischer, oder kognitivverhaltenstherapeutischer Richtung zum Einsatz. Zudem finden Fallsupervisionen mit Videoaufzeichnungen sowie Erfahrungen in einem Hypnose- oder Entspannungsverfahren (Progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training) katathym-imaginative Psychotherapie oder in körperlicher Psychotherapie statt:
- Bearbeitung schwieriger Gesprächssituationen und Emotionen (z.B. Wut, Angst)
- Klärung von bewussten und unbewussten Wünschen und Erwartungen sowie des Auftrages des Patienten
- Beurteilung, Planung und Einsatz angemessener therapeutischer Schritte (Behandlung, Beratung oder Überweisung)
- Analyse von Beziehungsabläufen, eigener Norm- und Idealvorstellungen
Formalia – Dokumentation in der Weiterbildung Psychosomatische und Psychosoziale Medizin
Ein Logbuch, wie für Facharztausbildungen üblich, gibt es für die Schwerpunktausbildungen nicht. Trotzdem werden zur Vergabe des Schwerpunkttitels und der Ausbildungscredits die einzelnen Abschnitte der Schwerpunktausbildung dokumentiert. Am Ende der Ausbildung ist die Führung des interdisziplinären Schwerpunktes an den Nachweis einer periodischen Fortbildung gebunden. Nach Ablauf von fünf Jahren wird der Schwerpunkt für jeweils weitere fünf Jahre erneuert, sofern die Kriterien der Fortbildungspflicht der Akademie SAPPM erfüllt wurden. Werden die Bedingungen für die Rezertifizierung nicht erfüllt, erlischt der Schwerpunkt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Rezertifizierung fällig wird.
Für wen ist die Schwerpunktausbildung interessant?
Die Schwerpunkt-Ausbildung in Psychosomatische und Psychosoziale Medizin eignet sich für Ärzte, die…
- …ganzheitlich arbeiten möchten und Interesse an der Verbindung zwischen körperlichen und psychischen Beschwerden haben
- …komplexe Patienten betreuen und häufig mit multimorbiden oder schwer einzuordnenden Symptomen konfrontiert sind
- …interdisziplinär denken und Brücken zwischen somatischer Medizin und Psychotherapie schlagen wollen
- …ihre psychotherapeutische Kompetenzen erweitern möchten
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin – Karriereperspektiven und Arbeitsumfeld
Nach Abschluss der Schwerpunktweiterbildung ergeben sich vielfältige Karrieremöglichkeiten. Ärzte können in Spitälern, Rehabilitationskliniken, psychosomatischen Fachzentren oder in eigener Praxis tätig sein. Auch eine Anstellung in interdisziplinären Teams oder bei Institutionen, die sich mit Arbeitsmedizin oder Stressbewältigung beschäftigen, ist möglich. Der Bedarf an spezialisierten Ärzten in diesem Bereich nimmt stetig zu, da psychosomatische Erkrankungen in der Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Fachärzte mit dem Schwerpunkt Psychosomatik können in verschiedenen medizinischen Einrichtungen tätig sein. Universitäts- und Kantonsspitaler bieten spezialisierte Abteilungen für Psychosomatik, Psychiatrie oder Innere Medizin, in denen interdisziplinäre Teams arbeiten. Auch Rehabilitationskliniken mit psychosomatischer Ausrichtung sowie psychosomatische Fachkliniken stellen potenzielle Arbeitgeber dar. Ambulatorien und psychosomatische Praxen bieten ebenfalls Anstellungsmöglichkeiten, ebenso wie Forschungsinstitute und Hochschulen, die sich mit psychosomatischen Erkrankungen befassen.
Mögliche Zusatzweiterbildungen
Nach Abschluss der Schwerpunktausbildung bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Spezialisierung. Dazu gehören beispielsweise:
- Psychokardiologie (psychosomatische Aspekte kardiovaskulärer Erkrankungen)
- Schmerztherapie mit psychosomatischem Schwerpunkt
- Psychoonkologie
- Psychotraumatologie
Diese Zusatzweiterbildungen bieten die Möglichkeit, sich auf bestimmte Patientengruppen oder Krankheitsbilder zu konzentrieren und die Expertise weiter zu vertiefen.
Passende Jobs
Die Nachfrage nach Fachärzten mit Schwerpunkt Psychosomatischer und Psychosozialer Medizin steigt kontinuierlich, da psychosomatische Erkrankungen immer häufiger diagnostiziert werden. Für Ärzte, die sich für eine Tätigkeit in der Psychosomatik entscheiden, eröffnen sich vielfältige Karrieremöglichkeiten in der Patientenversorgung, Forschung oder Lehre. Die Arbeit in diesem Fachgebiet ist anspruchsvoll, bietet jedoch auch grosse persönliche und berufliche Erfüllung, da sie einen tiefgreifenden Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten haben kann. Passende Stellenangebote gibt es hier.
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin – Wie hoch ist der Lohn?
Der Lohn von Ärzten in der Psychosomatik und Psychosozialen Medizin variiert je nach Tätigkeitsbereich und Berufserfahrung. In Spitälern liegt das Einstiegsgehalt für Assistenzärzte bei rund 100’000 CHF bis 120’000 CHF pro Jahr. Mit zunehmender Erfahrung und der Übernahme von leitenden Positionen kann das Jahresgehalt auf bis zu 200’000 CHF und mehr ansteigen. In eigener Praxis sind die Einkünfte abhängig von der Patientenzahl und der angebotenen Spezialisierung. Mehr zum Arzt-Lohn in der Schweiz: