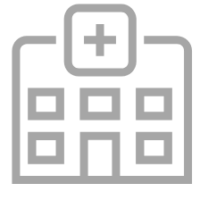Die Weiterbildung zum Facharzt für Ophthalmologie in der Schweiz ist eine anspruchsvolle und strukturierte Ausbildung, die Ärzten eine umfassende Qualifikation in der Diagnostik, Therapie und Chirurgie im Bereich der Augenheilkunde vermittelt. Ziel ist es, die fachliche Kompetenz zu entwickeln, um Patienten mit akuten und chronischen Augenerkrankungen auf höchstem medizinischem Niveau zu versorgen.
Inhaltsverzeichnis
Facharzt Augenheilkunde – Tätigkeiten
Augenärzte diagnostizieren und behandeln Erkrankungen und Funktionsstörungen des Auges sowie des Sehsystems. Sie führen Sehtests und augenärztliche Untersuchungen durch, erkennen und überwachen Erkrankungen wie Glaukom, Katarakt oder Makuladegeneration. Neben der konservativen Behandlung, z. B. mit Medikamenten oder Sehhilfen, führen viele auch operative Eingriffe wie Katarakt- oder Lidchirurgie durch. Dabei arbeiten sie oft interdisziplinär mit Hausärzten, Optikern oder anderen Fachspezialisten zusammen. Mehr zu Karriere und Aufgaben als Augenarzt:
Übersicht aller Facharztausbildungen und Fachrichtungen:
Facharzt Augenheilkunde – Voraussetzungen
Voraussetzung für die Aufnahme der Facharztweiterbildung ist ein abgeschlossenes Medizinstudium mit eidgenössischem Arztdiplom oder einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Abschluss. Darüber hinaus sind gute Kenntnisse in der Sprache der jeweiligen Weiterbildungsstätte erforderlich, um den klinischen Alltag, die Supervision und die Dokumentation sicher bewältigen zu können.
Facharzt Augenheilkunde – Dauer und Gliederung
Die Facharztweiterbildung in Ophthalmologie dauert insgesamt fünf Jahre. Davon entfallen vier Jahre auf die fachspezifische klinische Weiterbildung in der Ophthalmologie. Mindestens ein Jahr dieser klinischen Weiterbildung muss an einer Weiterbildungsstätte der Kategorie A erfolgen. Zudem sind mindestens 18 Monate in einem ambulanten Setting (Ambulatorium, Poliklinik oder Praxisassistenz) sowie mindestens vier Monate im stationären Bereich zu absolvieren. Eine gemischt ambulant-stationäre Tätigkeit wird anteilsmässig angerechnet.
Ein Jahr der klinischen fachspezifischen Weiterbildung muss an einer zweiten anerkannten Weiterbildungsstätte erfolgen. Ein Jahr der Weiterbildung kann als nicht-fachspezifische Weiterbildung in bestimmten anderen medizinischen Fachgebieten oder alternativ als Forschungstätigkeit erfolgen. Ab dem dritten Weiterbildungsjahr können bis zu sechs Monate in Form einer Praxisassistenz absolviert werden, wobei maximal ein Monat davon als Praxisvertretung angerechnet werden darf. Voraussetzung ist, dass ein Facharzt auf Abruf zur Verfügung steht.
Facharzt Augenheilkunde – Inhalte der Weiterbildung
Die Facharztweiterbildung für Kandidaten in der Ophthalmologie ist hochspezialisiert und enthält neben den allgemeinen medizinischen Grundfächern auch eine Reihe besonderer Inhalte, die sich oft grundlegend von anderen medizinischen Bereichen unterscheiden und auch ein gutes physikalisches Verständnis des Auges und seiner Funktionen voraussetzen.
Allgemeine ophthalmologische Untersuchungsmethoden
- Refraktion
- Skiaskopie
- Refraktometrie manuell oder automatisch
- Bestimmung von Pupillenmitten- und Hornhautscheitelabstand
- Simulations- und Aggravationsproben
- Auffallendes, fokales, regredientes Licht mit den geeigneten Hilfsmitteln (Lampe, Ophthalmoskop)
- Äussere Inspektion
- Motilität und Konvergenz
- Lidstellung und Lidschluss
- Pupillomotorik
- Lichtprojektion, Aderfigur und entsprechende entoptische Phänomene
- Spaltlampe
- Bedienung und Ausschöpfen ihrer Möglichkeiten; Zusatzuntersuchungen wie Pachymetrie, Messung der Vorderkammertiefe, Tonometrie, Lotmar-Visometer
- Beleuchtung diffus, fokal, mit Spalt, im regredienten Licht, im Sklerastreulicht und im Spiegelbezirk
- Vitalfarbstoffe
- Trübungsmessungen im regredienten Licht
- Lensmeter, Flaremeter und Fluorophotometer (prakt. Durchführung nicht verlangt) – Tonometrie
- Applanationstonometer, Überprüfung der Eichung, Astigmatismus
- Indentationstonometer
- Pascal Tonometer
- Non-Contact-Tonometer
- Druckkurve – Tonographie (prakt. Durchführung nicht verlangt) – Ophthalmodynamometrie (prakt. Durchführung nicht verlangt) – Keratometrie
- Javal-Regeln
- Computerunterstützte Video-Keratometrie (prakt. Durchführung nicht verlangt)
- Ocular response Analyzer
- Pachymetrie
- Konfokale Hornhautmikroskopie
- Exophthalmometrie
- Hornhautsensibilität
- Gesichtsfelduntersuchung
- Kontaktglasuntersuchung mit gängigen Kontaktglastypen
- Farbsinnprüfung
- Kontrastempfindlichkeit (Vistech-Tafeln u.a.)
- Wellenfrontmessung
- Diaphanoskopie
- Elektrophysiologie
- Adaptometrie: Theorie und Interpretation (prakt. Durchführung nicht verlangt)
- Photographie und Videodokumentation
- Optomap Netzhautuntersuchung
- Fluoreszenzangiographie
- Optische Kohärenztomographie
- OCT-Angiographie
- Heidelberg Retina Tomogramm, GDx Nerve Fiber Analyzer
- Ultraschalldiagnostik
- Auskultation des Kopfes
- Palpation der Lymphknotenstationen
- Palpation von Orbita und Periorbita
Grundlagenfächer
Anatomie und Pathologie
- Makroskopische Anatomie
- Mikroskopische Anatomie
- Beurteilung einfacher Schnittpräparate
- Pathologie: soweit für das Verständnis des einzelnen Krankheitsbildes notwendig, Beurteilung einfacher Schnittpräparate (Konjunktivalabstriche, Zytologie, Bakteriologie)
«Mechanismus des Sehens»
- die 7 Funktionen der Netzhaut und deren Prüfung
- örtliche Auflösung (Visus)
- zeitliche Auflösung (Flicker)
- räumliche Prüfung, Lichtunterschiedsempfindlichkeit (GF)
- Kontrastsehen
- Adaptation
- Farbensehen
- Bewegungssehen
- photochemische Aspekte des Sehens, Netzhautmetabolismus, elektrophysiologische Phänomene
Muskuläre Mechanismen (siehe Strabismus und Neuroophthalmologie)
Visuelle Perzeption, Binokularsehen
- Monokulares/binokulares Sehen
- Rezeptive Felder/perzeptive Felder, Binokularneurone, kortikale Säulen
- Normale NH-Korrespondenz, binokulare Richtungswahrnehmung
- Fusion, Tiefenschärfe, Punkt und Flächenstereopsis
- Entwicklung der Stereopsis, Deprivation
- Halluzination/Illusion
Physiologische Optik (siehe Optik und Refraktion)
Vegetative Physiologie inklusive Biochemie okulärer Strukturen
- Funktioneller Aufbau der einzelnen okulären Strukturen
- Lider und Zilien, Drüsen, Bewegungen etc.
- Tränen
- Bindehaut
- Hornhaut
- Intraokulardruck und Kammerwasser (Zusammensetzung und Zirkulation)
- Zirkulationsschranken der Gefässe (Blut/Kammerwasser und Blut/Retina aussen und innen)
- Aufbau und Funktion der Linse
- Aufbau und Funktion des Glaskörpers
- Ziliarkörper, Akkommodation, Presbyopie
- Aderhaut und Pigmentepithel – funktionelle und topographische Organisation der Netzhaut und Sehbahn
Pharmakologie
Grundkenntnisse
- Pharmakologie mit Toxikologie und Teratologie
- Pharmakokinetik mit Verteilungsvolumen, Kompartiment, Invasion und Elimination, Halbwertszeit, Interferenz, Pharmakogenetik
- Kenntnisse des therapeutischen Nutzens (Kosten-Nutzenrelation) und der rechtlichen Grundlagen für die Verschreibung und Kontrolle von Arzneimitteln in der Schweiz.
- Grundkenntnis der Therapie mit Strahlenträgern
- Kenntnis der Pharmakologie und konservativen Therapie bei Erkrankungen der äusseren Augenabschnitte
- Augenmuskelstörungen
- Pupillenstörungen und autonomes Nervensystem
- Katarakt
- Glaukom
- Infektionskrankheiten
- Vaskuläre Erkrankungen
- Netzhaut- und Aderhauterkrankungen
- Trockenes Auge und Tränenprobleme
- Uveitis und Immunsuppressiva
- Anästhetika
- Diagnostika
Applikationsort
- lokale Therapie mit Tropfen, Gel, Salben, «Systemen» (transdermale Therapeutika)
- Iontophorese
- Injektionen von Lösungen und Kolloiden, systemische Therapie mit Tabletten, Kapseln, Flüssigkeiten, Injektabilia
Optik und Refraktion
Physikalische Optik
Grundbegriffe der physikalischen Optik
- Geometrische Optik
- Grundlagen der optischen Abbildung
- Reflexionsgesetz, Brechungsgesetz, Prisma, Brechungsindex, Abbé-Zahl
- Optik von sphärischen Flächen
- Konvex-, Konkav-, Zylinderlinse
- Abbildungsfehler von Linsen – Wellenoptik
- Elektromagnetische Strahlung, Interferenz, Beugung, Hologramm, Polarisation
- Lichttechnik
- Photometrische Grundbegriffe (Lumen, Candela, cd/m2, asb, Lux)
- Lichtquellen (Tageslicht, Glühlampen, Leuchtstofflampen, Laser), spektrale Zusammensetzung
Physiologische Optik
Grundbegriffe der physiologischen Optik
- Emmetropes Auge, schematisches Auge nach Gullstrand
- Fehlsichtiges Auge (Myopie, Hyperopie, Aphakie, Pseudophakie, Astigmatismus)
- Akkommodation
- Ruhelage
- Akkommodations- und Fusionsbreite, AC/A-Quotient-Akkommodation-Vergenz-Diagramm
- Presbyopie
- Auflösungsvermögen des Auges (Landoltring, Vernier), Visus
- Das Brillen-Auge
- Änderungen der Raumwahrnehmung und des Gesichtsfelds
- Akkommodationsaufwand und -erfolg
- Anatomische Brillenanpassung, Brillenglaszentrierung
Brillenglasbestimmung: objektiv, subjektiv
- Objektive Refraktion
- Skiaskopie
- Refraktometer (inkl. automatische)
- Ophthalmometer – Subjektive Refraktion
- Abhängigkeit des Rohvisus von der Ametropie (Sphäre und Astigmatismus)
- Sphären Refraktion (bestes sphärisches Glas, Nebelmethode, Donders-Methode, Rot-Grün-Abgleich, Feinabgleich)
- Astigmatismus Refraktion mit Kreuzzylinder
- Binokularabgleich (Probiergläser oder Phoropter)
- Ausschluss resp. Berücksichtigung einer grösseren Heterophorie
- Bestimmung der Nahbrille (Akkommodometer, Nahprüfgerät, Nahzusatz, Nahastigmatismus) Fachärztin oder Facharzt für Ophthalmologie
- Umsetzen des Refraktionsergebnisses in die Daten der Brille
- Ergo-Ophthalmologie: Wahl des Brillentyps nach der Sehanforderung (welche Brille für welchen Beruf, welchen Arbeitsplatz?)
Brillenoptik
- Eigenschaften, Vor- und Nachteile von Mono-, Bi- und Trifokal-Gläsern sowie Gleitsichtgläsern
- Überprüfen der Brillenglaszentrierung
- Spezialgläser wie asphärische Gläser, Gläser mit hohem Brechungsindex, Lentigläser, organische Gläser, Entspiegelung, Tönung, phototrope Gläser, Filtergläser, Härtebeschichtung
Vergrössernde Sehhilfen
- Besonderheiten der Refraktionsbestimmung Sehbehinderter für Ferne und Nähe
- Nicht-vergrössernde Sehhilfen
- Spektrum der vergrössernden Sehhilfen
- Beratung Sehbehinderter: Kenntnis der Hilfsinstitutionen und der Möglichkeiten finanzieller Zuwendungen
Kontaktologie
- Kontaktlinsen (KL)
- KL-Indikationen und -Kontraindikationen
- Optische Komponente der KL-Versorgung, Tränenlinse, Überrefraktion
- Physiologische Veränderungen und Adaptation des Auges an die KL
- Materialkenntnisse, ihre Vor- und Nachteile
- KL-Pflege
- Anpassung kosmetischer KL theoretisch und in kleinerem Rahmen auch praktisch
- KL-Nachkontrollen, Sitzbeurteilung, Früherkennen von Komplikationen und deren Behandlung
- Therapeutische Verbandschalen: gründliche Kenntnisse und korrekte, selbständige Anpassung
Strabologie und Neuro-Ophthalmologie
Motorik
- Anatomie, Innervation, Zugwirkung der Augenmuskeln
- Motilitätsprüfung
- Kopfzwangshaltung
- Sherrington’sches Gesetz der reziproken Innervation
- die Versionen
- Hering’sches Gesetze der seitengleichen Innervation
- die Vergenzen
- die Duktionen
- die Rotationen (inkl. Zyklorotation)
- die Sakkaden
- die Nystagmen
- Inkomitierende Schielformen primärer und sekundärer Sehwinkel, Inkomitanzmuste
- Myopathien
- Myopie, endokrine Myopathie, Myositis
- Neuromuskuläre Überleitung
- Myasthenia gravis und ähnliche Leiden
- Neurale Prozesse und nukleäre Störungen
Sensorik
- monokulares Sehen, binokulares Einfachsehen
- Horopter und Panum’sches Areal
- Fusion
- Diplopie monokular, binokular
- Kompensationsmechanismen, Suppression, Kopfzwangshaltung
- Amblyopie
- Anomale Netzhautkorrespondenz
Diagnostik
- Anamnese
- Inspektion
- Hirschberg’sche Bildchen, Pseudostrabismus
- Covertest Ferne/Nähe mit ev. Winkelmessung
- Untersuchung des Binokularsehens und der Stereopsis (Treffversuch) Streifengläser nach Bagolini
- Ophthalmoskopische Korrespondenzprüfung
- Dunkelrotglas nach Maddox; Graefe; Schober; 4-Lichtertest nach Worth Messung mittels Nahprüfgerät; Maddox-Wing
- Inkomitanzmessunge
- Synoptophor nicht verlangt
Einteilung und Formen des Strabismus
Heterophorien
- Phorieverdächtige Symptome in der Anamnese
- Phoriemessmethoden gemäss Abschnitt
- Korrektur nach der analytischen Methode (Regeln nach Percival und Sheard, Donders-Linie, Zone des binokularen Einfachsehens)
- Messung und Korrektion nach Polatest-Methode:
- Theoretische Grundlagen, Gemeinsamkeiten mit klassischer Strabologie
- Korrekter Ablauf des Untersuchungsgangs
- Kenntnis der einzelnen Stadien des subnormalen Binokularsehens Fachärztin oder Facharzt für Ophthalmologie
- Problematik der Prismenkorrektion
Begleitschielen, Strabismus concomitans
- Frühkindliches Begleitschielen
- kindliche Spätstrabismen
- Akkommodativ beeinflusste Schielformen
- Intermitierende Schielformen
- Störungen des Binokularsehens, herabgesetztes Binokularsehen im Sinn von Fusions- und Vergenzstörungen, subnorm. Binokularsehen, usw.
Bewegungsstörungen, Inkomitierende Schielformen
- Orbitale Bewegungsstörungen, muskulär, nicht muskulär (Orbitaverletzungen, andere Orbitopathologie, nach Amotiooperationen, myogene Paresen: Myositis, degenerativ, endokrine Orbitopathie)
- Neuromuskulärer Übergang (Myasthenie)
- Neurogene Paresen N. III, IV, VI
- Fehlinnervationssyndrome, Retraktionssyndrome u.a.
- Supranukleäre Bewegungsstörungen: Störungen der Blickmechanismen
- Internukleäre Bewegungsstörungen
Konservative Schieltherapie
- Refraktionsausgleich
- Okklusions- und Amblyopiebehandlung
- Prismentherapie
Grundlagen der operativen Schielbehandlung
- Nystagmus
- Definitionen, Amplitude, Frequenz
- Nystagmusformen
- Kongenitaler Nystagmus, Okulärer Nystagmus
- Erworbene Nystagmus-Formen
- Kopfschmerzen (Augenbedingt)
- Asthenopie
- dioptrische Asthenopie
- artifizielle Asthenopie
- muskuläre Asthenopie: Keratitis neuroparalytika, Heterophorie, Konvergenzinsuffizienz
- nervöse Asthenopie
- Differentialdiagnose mit anderen Ursachen von Kopfschmerzen
- Pupille
- Anatomie, Physiologie
- Relativer afferenter Pupillen-Defekt (Marcus Gunn Pupille)
- Pupillenstörungen
- Pharmakologische Tests: Paredrin, Cocain, Pilocarpin in schwacher Konzentration
- Papillenoedem
- Okulär
- Metabolisch
- Inflammatorisch
- Infiltrativ
- Systemische Krankheit
- Papillentumor
- Vaskulär
- Orbitale Tumoren
- Intrakranielle Hypertension
- Papillenatrophie
- Glaukom
- Trauma
- Kompressive optische Neuropathie
- Hereditär
- Bestrahlungsbedingte optische Neuropathie
- Toxische und Nahrungsdefizienz-Neuropathie
- Post-Retrobulbärneuritis
- Papillenanomalien
- Exophthalmus
- Topische Diagnose von Läsionen im visuellen sensorischen System
Diagnostik und Therapie der ophthalmologischen Notfälle
Visusverminderung / Visusverlust
- Augenlider
- Ptosis
- Lagophthalmus
- Fehlstellung als Folge einer Krankheit, Missbildung
- Vordere Bulbusabschnitte und brechende Medien
- n. intraokulärer Operation mit deren Komplikationen
- Degenerative Erkrankung der Aderhaut, intraokulare Tumoren, Makula-Blutung
- Glaskörperabhebung, vitreoretinale Traktion, Netzhautriss, Glaskörpereintrübungen: Blutungen, Entzündungen, Infektionen, Chorioretinitis, infektiöser Typ (Toxoplasmose, CMV, Tuberkulose, Retinitis luica, usw.) – Chorioretinitis centralis serosa
- Retinitis exsudativa externa Coats, Vaskulitiden, a-v Malformation, hypertensive Retinopathie
- Netzhautgefässverschlüsse:
- Arterielle Verschlüsse (Zentralarterienverschluss, Arterienastverschluss)
- Venöse Verschlüsse (Zentralvenenverschluss, Venenastverschluss)
- Neovaskularisation der Netzhaut und Papille
- Netzhautablösung:
- rhegmatogene Amotio, Traktionsamotio, exsudative Ablösung
- Sehnervenerkrankungen, wie: Neuritis nervi optici, Arteriitis temporalis
- Stauungspapille (Raumforderung/internistisches Problem?)
- Sehbahnaffektionen
- Ischämischer/Kompressions-Befall (i. b. GF-Ausfälle erkennen):
- Chiasmaregion
- Tractus opticus-Corpus geniculatum
- Sehstrahlung
- Sehrinde
- Hysterie
- Intoxikation (z.B. Methylalkohol, Medikamente)
- Trauma: Contusio bulbi, Contusio N. optici, Contusio cerebri
Notfälle durch Infektionen / Entzündungen
- Augenlider
- Entzündung/Infektion der Lider:
- Hordeolum, Chalazion
- Herpes simplex
- Zoster ophthalmicus
- Blepharitis
- Oedem (unterscheiden: entzündliches/infektiöses, ekzematöses, allergisches, Quinckesches, angioneurotisches Lidoedem)
- Tränenwegsystem
- Dacryoadenitis, Dacryocystitis
- Orbita
- Orbitaabszess, Sinus cavernosus-Thrombose
- nicht-infektiöses Lidoedem, «orbital Cellulitis»
- Sinusitis
- Exophthalmus
- Pulsierender Exophthalmus
- maligner endokriner Exophthalmus
- Verletzungen
- Hämatom (unterscheiden von einem Tumor)
- Emphysem (Fraktur der Lamina papyracea)
- Perforation, Wunden – Bulbus – Bindehaut
- Konjunktivitis u. a. Ophthalmia neonatorum, bakterielle-/Virus und Chlamydien-/allergische- (+ follicularis/vernalis) (Kerato-)Konjunktivitis photoelektrika. Sicca – Chemosis – Kornea – Keratitis
- Ulcus serpens (nach Erosio), Ulcus corneae
- Keratomykose
- Keratomalazie
- Superficialis punctata e lagophthalmo
- Neuroparalytica
- Hornhautoedem: u.a: Endotheldekompensation bei Vorderkammerlinse
- Keratokonus in Dekompensation
- Fuchs Endotheldystrophie in Dekompensation
- Sklera Episkleritis
- Skleritis (anterior, posterior)
- Skleromalacia perforans (Zusammenhang mit rheumatischen Erkrankungen, öfters autoimmun)
- Regenbogenhaut
- Akute Iritis
- Chronische Iridozyklitis (Fuchs’sche Heterochromiezyklitis u.a.)
- Linse
- Linsenluxation/Verlagerung
- Linsenperforation (Trauma; phakoanaphylaktisches Glaukom)
- Vorderkammer und Glaskörper
- Endophthalmitis
Augeninnendrucksteigerungen
- akuter Glaukomanfall
- Hornhaut-Läsionen kombiniert mit Irisadhärenz
- Uvea: vordere/hintere Uveitis
- Aderhaut-/Ziliarkörper-/Iristumoren
- Irido-korneoendotheliale und verwandte Syndrome
- Linseninduzierte Drucksteigerungen
- Subluxation/Dislokation der Linse, intumeszente Linse
- phakoanaphylaktische Reaktion
- Trauma
- Blutung in die vordere/hintere Kammer oder in Glaskörper
- Recessus anguli
- hämolytisches Glaukom, ghost-cell Glaukom
- Gefässbedingte Drucksteigerungen
- Zentralvenenverschluss, Zentralarterienverschluss
- Rubeosis iridis (neovaskuläres Glaukom)
- Medikamenteninduziert (Steroidglaukom, lokal/systemisch)
- Orbitaveränderungen:
- Tumoren, Entzündung, Carotis cavernosus-Fisteln, endokrine Orbitopathie
- postoperativ / traumatisch (perforierende Verletzung, «epithelial ingrowth»)
Traumatologie
- nicht penetrierende / perforierende Verletzungen des Auges
- oberflächliche Hornhaut-Verletzungen
- Contusio bulbi
- konjunktivale Blutungen, Hyphäma, Iridodialyse, traumatische
- Aniridie
- Ziliarkörperablösung, Kammerwinkelrezessus, traumatische
- Katarakt/Dislokation der Linse, GK-Blutung, Aderhautruptur,
- Aderhautblutung, chorioretinale Ruptur
- Netzhautblutung/Netzhautödem, traumatische Netzhautablösung – chemische/physikalische Schädigung
- chemische Säure-/Laugenverätzungen, 3 Schweregrade physikalische:
- Ultraviolett, Infrarot, Verbrennungen, ionisierende Strahlung
- gedeckte Bulbusruptur
- Penetrierende/perforierende Augenverletzungen
- Optikusschädigung
- Trauma der Augenlider, Orbita und Adnexe
Neuro-ophthalmologische Notfälle, inklusive Pupillen- und Motilitätsstörungen
- Pupille
- Amaurotische Pupillenstarre
- Pupillenstarre
- Reflektorische Pupillenstarre
- Anisokorie
- Reizmiosis
- Pupillotonie
- Naheinstellung
- Augenmotilität:
- supranukleäre, internukleäre und periphere Störungen
- Amaurosis fugax
- Schmerzsyndrome im Ophthalmologiebereich:
- Migräne
- Trigeminusneuralgie
- Vasomotorische Schmerzen
- Hirntumoren
- Meningitis, Enzephalitis
- Exophthalmus
Auge und systemische Erkrankungen, inklusive Genetik und Immunologie Ziel
- Chromosomale Erkrankungen
- Deletions-Syndrome
- Geschlechtschromosomale Erkrankungen
- Trisomie-Syndrome
- Kardiale Erkrankungen
- Kollagen-Erkrankungen
- Endokrine Erkrankungen
- Hypophysen-Erkrankungen
- Gastrointestinale Erkrankungen
- Erkrankungen des Hörapparates
- Hämatologische Erkrankungen
- Erkrankungen des Immunsystems (inkl. AIDS)
- Infektiöse Erkrankungen
- Entzündliche Erkrankungen unbekannter Ätiologie, M. Boeck
- Maligne Tumoren / Erkrankungen des lymphoretikulären Systems, Metastasen, Non-Hodgkin Lymphome, «Remote effects of cancer»
- Metabolische Erkrankungen
- Muskel-Erkrankungen
- Erkrankungen des neuro-muskulären Übergangs
- Phakomatosen
- Physikalische / chemische Einwirkungen
- Schwangerschaft
- Lungen-Erkrankungen
- Nieren-Erkrankungen
- Skelett-Erkrankungen
- Faziale Missbildungen
- Andere Entwicklungsstörungen
- Haut-/ Schleimhaut-Erkrankungen
- Bindegewebs-Erkrankungen, siehe auch unter Kollagenosen
- Pigment-Störungen
- Vaskuläre Erkrankungen
- Vitamin-Erkrankungen
Erkrankungen von Lidern und Bulbus
Äussere Abschnitte, Orbita und Tränenwege
- Hauterkrankungen der Lider, die Lider als Schutzapparat des Auges, seine Störungen
- Epiphora
- Affektionen der Tränendrüse, ableitende Tränenwege
- Fähigkeit zur selbständigen Durchführung von Eingriffen an Lidern und Bindehaut, sofern sich die Veränderungen auf eine Resektionsebene, eine Nahtebene und auf eine Ausdehnung von 5 mm beschränken.
Vorderes Segment
- Erkrankungen der
- Konjunktiva
- Sklera
- Kornea
- Vorderkammer
- des Ziliarkörpers
- der Zonula und der Linse
Hinteres Segment
- Erkrankungen
- des Glaskörpers
- der Aderhaut
- der Netzhaut
- des Sehnervkopfs
Facharzt Augenheilkunde – Die Facharztprüfung
Die Facharztprüfung für Ophthalmologie ist Teil des European Board of Ophthalmology und gliedert sich in einen schriftlichen sowie vier mündliche Prüfungsteile. Im schriftlichen Examen beantworten die Kandidaten 52 Multiple-Choice-Fragen innerhalb von 2,5 Stunden. Die Inhalte decken das gesamte Fachgebiet der Augenheilkunde ab, unter anderem Optik, Kinderophthalmologie, Katarakt, Netzhaut, Neuro-Ophthalmologie und pharmakologische Aspekte.
Das mündliche Examen besteht aus vier Fachgesprächen von jeweils 15 Minuten, die von insgesamt acht Examinatoren durchgeführt werden. Die Themen umfassen Bereiche wie Refraktion, Strabismus, vorderes und hinteres Segment des Auges sowie entzündliche Erkrankungen.
Dabei werden sowohl klinische Fertigkeiten als auch die diagnostische und therapeutische Entscheidungsfindung geprüft. Die Beurteilung erfolgt teils anhand von Patientenbeispielen, teils anhand dokumentierter klinischer Fälle.
Das Logbuch
Während der gesamten Weiterbildungszeit führen die Weiterbildungskandidaten ein elektronisches Logbuch (e-Logbuch), in dem alle relevanten Lerninhalte, durchgeführten Eingriffe, Fallzahlen und absolvierte Kurse dokumentiert werden.
Das Logbuch dient als Nachweis für die Erfüllung der Weiterbildungsanforderungen und ist Voraussetzung für die Zulassung zur Facharztprüfung. Die regelmäßige Validierung durch die Weiterbildungsleitung stellt sicher, dass der Ausbildungsstand dem geforderten Niveau entspricht.
Jobs als Arzt in der Augenheilkunde
Augenärzte in der Schweiz können in verschiedenen medizinischen Einrichtungen tätig sein. Häufig arbeiten sie in Augenarztpraxen – entweder selbstständig oder angestellt – oder an Augenkliniken in öffentlichen oder privaten Spitälern. Weitere Einsatzorte sind medizinische Versorgungszentren, universitäre Kliniken mit Forschungsschwerpunkt sowie Rehabilitationszentren für sehbehinderte Patienten. Manche sind auch in der medizinischen Beratung, bei Versicherungen oder im Bereich der Medizintechnik/Industrie tätig.
Auf der Suche nach einer passenden Stelle?