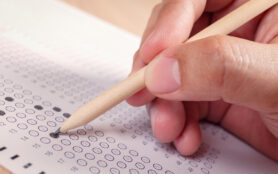Mit einem einstimmigen Entscheid hat der Grosse Rat des Kantons Bern eine Motion angenommen, die zusätzliche Medizinstudienplätze fordert. Der Vorstoss ist Teil einer Reihe von Schritten, um dem wachsenden Ärztemangel in der Schweiz zu begegnen. Er umfasst darüber hinaus Forderungen nach baulichen Erweiterungen und gezielter Förderung von Fachrichtungen, die derzeit unterversorgt sind.
Inhaltsverzeichnis
Der Beschluss im Detail
Der Grosse Rat des Kantons Bern hat mit 149 zu 0 Stimmen entschieden, die Zahl der Studienplätze in der Humanmedizin an der Universität Bern weiter zu erhöhen. Gleichzeitig sprach sich das Parlament dafür aus, den Ausbau der notwendigen Infrastruktur mit hoher Priorität voranzutreiben. Viele Lehrbereiche sind bereits heute an der Kapazitätsgrenze angelangt. Provisorische Lösungen müssen herhalten, weil es an geeigneten Räumlichkeiten und Einrichtungen fehlt. Zudem wurde eine weitere Motion gutgeheissen, die eine gezielte Förderung von Studierenden vorsieht, welche in besonders unterversorgten Fachrichtungen tätig werden sollen – sei es in peripheren Regionen oder in Disziplinen, in denen die Grundversorgung gefährdet ist.
Zur Einordnung: Bereits 2017 war die Zahl der Plätze im ersten Studienjahr von 220 auf 320 erhöht worden, 2022 folgte eine weitere Anhebung auf 335. Schon diese Schritte führten zu erheblichen Engpässen, die sich nun durch den neuerlichen Ausbau verstärken dürften. Der Regierungsrat äusserte sich im Vorfeld zwar grundsätzlich positiv, verwies jedoch auf die beträchtlichen finanziellen Belastungen, die ein solcher Ausbau nach sich ziehen werde.
Wie passt Berns Entscheid in das nationale Bild?
Bern ist mit dem Problem des Ärztemangels nicht allein. Auf nationaler Ebene gibt es seit einigen Jahren ein Bundesprogramm, das die Zahl der Abschlüsse in Humanmedizin von rund 900 im Jahr 2016 bis 2025 auf etwa 1’300 erhöhen soll. Dennoch zeigen Prognosen von PWC, dass sich der Mangel weiter verschärfen dürfte: Bis 2040 könnten in der Schweiz rund 5’500 Ärzte fehlen, falls nicht deutlich mehr Ausbildungs- und Weiterbildungsplätze geschaffen werden. Laut der FMH-Statistik waren 2023 zwar bereits rund 42’100 Ärzte in der Schweiz tätig, ein spürbarer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Eine ausführliche Übersicht gibt es hier:
Doch trotz dieser Zunahme deutet sich in vielen Regionen und Fachgebieten eine Unterversorgung an. Gründe dafür sind der demographische Wandel, die Überalterung der Ärzteschaft sowie der Umstand, dass viele Ärzte in Teilzeit arbeiten. Hinzu kommt, dass ein erheblicher Teil des Bedarfs durch im Ausland ausgebildete Fachkräfte gedeckt wird. Diese Abhängigkeit ist nicht ohne Risiken, da Ausbildungshintergrund, Rückkehrquoten und längerfristige Perspektiven deutlich weniger planbar sind.
Herausforderungen und offene Fragen
Der Beschluss in Bern wirft mehrere Fragen auf, die auch in anderen Kantonen und auf Bundesebene relevant sind:
- Finanzierung und Ressourcen: Ausbau von Infrastruktur (Lehrgebäude, Labore, Simulationszentren etc.) und Personal sind teuer. Wer trägt die laufenden Kosten? Kommt der Bund ins Spiel oder tragen vorwiegend die Kantone?
- Quantität vs. Qualität: Mehr Studienplätze allein reichen nicht. Es muss sichergestellt sein, dass die Ausbildung qualitativ hoch bleibt. Das schliesst Betreuung, Praxisbezug, klinische Ausbildungsplätze und Lehrkapazitäten ein.
- Fachrichtungen gezielt fördern: Unterversorgte Disziplinen wie Allgemeinmedizin, Kinderheilkunde, Psychiatrie oder auch ländlich geprägte Regionen brauchen besondere Anreize – etwa finanziell, strukturell oder durch bessere Arbeitsbedingungen.
- Arbeitsbedingungen und Ärztebindung: Attraktivität des Arztberufs hängt nicht nur von Studienbedingungen ab, sondern stark von Arbeitszeitmodellen, Teilzeitoptionen, Familienfreundlichkeit und administrativer Entlastung. Studien zeigen, dass Assistenzärzte unter Druck stehen und frühzeitig ausscheiden.
- Auswahlverfahren (Numerus clausus, Eignungstest EMS etc.): Derzeit sind Zulassungstests wie der EMS und der Numerus clausus zentrale Hürden. Ob und wie diese Verfahren reformiert werden sollten, ist Teil der Diskussion.
Fazit
Der Entscheid des Grossen Rates von Bern ist ein deutliches politisches Signal: Man will handeln und das bald. Für Ärzte in der Schweiz bedeutet das: Es öffnet sich eine Chance, die Versorgung in Problemregionen zu verbessern, die Abhängigkeit von ausgebildeten Kollegen aus dem Ausland zu verringern und die Berufsperspektive von angehenden Medizinstudierenden realistischer zu gestalten. Ob Berns Vorstösse ausreichen, um dem prognostizierten Mangel nachhaltig entgegenzutreten, wird sich zeigen. Aber sie sind ein Baustein und sie machen Druck auf andere Kantone und den Bund, ähnliche Schritte zu unternehmen.