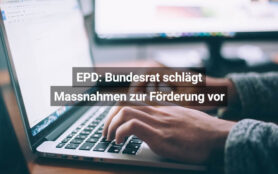Der Bundesrat hat im September 2025 die Botschaft zur Teilrevision des Heilmittelgesetzes verabschiedet. Ein zentrales Anliegen: Ab sofort sollen medizinische Verschreibungen nur noch elektronisch erfolgen dürfen – handschriftliche Rezepte werden der Vergangenheit angehören.
Warum das E-Rezept zwingend werden soll
Der Bundesrat begründet die Massnahme mit dem Ziel, die Patientensicherheit zu erhöhen. Elektronisch ausstellbare Rezepte sind besser lesbar, vermindern Medikationsfehler und verhindern Fälschungen sowie missbräuchliche Mehrfacheinlösungen. Zudem sind Rezeptmissverständnisse durch unleserliche Handschrift künftig ausgeschlossen.
Elektronischer Medikationsplan als neue Pflicht
Erstmals verpflichtet der Bundesrat Ärzte, nicht nur ein E-Rezept zu erstellen, sondern zusätzlich einen elektronischen Medikationsplan für jede verschriebene Verordnung anzulegen. Dieser Plan enthält eine Liste der Medikamente sowie Hinweise zur Anwendung und wird laufend aktualisiert. Auf Wunsch des Patienten kann er auch physisch ausgedruckt werden: Das Rezept bleibt elektronisch, handschriftliche Signaturen entfallen. Ziel ist eine verbesserte Therapietreue, bessere Kommunikation zwischen Gesundheitsfachpersonen und geringere Risiken durch Arzneimittelkollisionen.
Spitäler müssen elektronische Dosierungsberechnung verwenden
Eine weitere Neuerung betrifft die Pädiatrie: Spitäler sind künftig verpflichtet, individuelle Kinderdosierungen elektronisch zu berechnen. Damit soll menschlichem Rechenfehler vorgebeugt werden. In einem zweiten Schritt will der Bundesrat diese Verpflichtung auch auf ambulante Praxen ausweiten.
Mit der Teilrevision des Heilmittelgesetzes führt der Bundesrat zudem eine bessere, an das EU-Recht angeglichene Regelung für Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) ein. Das Ziel: schnellerer und sicherer Zugang der Schweizer Bevölkerung zu innovativen Therapien.
Die Vorlage wurde dem Parlament übergeben und muss dort noch beraten und verabschiedet werden, bevor sie in Kraft treten kann.
Stand der Einführung: Rückblick auf Pilotphase und technische Rahmenbedingungen
Bereits im Dezember 2023 hatte der Bundesrat die Revision zur Konsultation freigegeben. Seither haben FMH und pharmaSuisse ihre Kräfte gebündelt, um das E-Rezept technisch und organisatorisch voranzutreiben. Pilotprojekte zeigten positive Resultate, und erste Apotheken – laut letzter Zählung rund 356 – nahmen das E-Rezept in ihr System auf. Die technischen Standards wurden so gestaltet, dass sie mit dem elektronischen Patientendossier (EPD) kompatibel sind – was den Informationsfluss im Gesundheitswesen weiter verbessern soll. Zudem ist das E-Rezept Schweiz eine gemeinsame Initiative von FMH und pharmaSuisse. Der Dienst wurde so aufgebaut, dass keine vertraulichen Patientendaten zentral gespeichert werden müssen. Seit 2024 gibt es eine landesweite Einführungsperspektive.
Ausblick für die Arztpraxis
Wer heute bereits Spitäler oder Praxen betreibt, sollte die vorhandene E-Rezept-Infrastruktur prüfen und schrittweise vorbereiten. Spätestens jetzt ist die Zeit, sich auf die technische Umstellung einzurichten. Die Zusammenarbeit mit Softwareanbietern wird entscheidend: Praxissysteme müssen E-Rezepte und Medikationspläne reibungslos integrieren können. Der Bund verzichtet auf ein eigenes System für elektronische Verschreibungen. Die Praxis muss auf private Anbieter setzen, wie sie etwa durch den E-Rezept Schweiz Service oder andere zertifizierte Plattformen angeboten werden.
Die Teilnahme am EPD ist zunehmend verbindlich. Insbesondere für Leistungserbringer, die über die OKP abrechnen wollen. Die vermehrte Nutzung des EPD wird besonders in Kombination mit dem E-Rezept das Zusammenspiel im Gesundheitswesen deutlich verbessern.