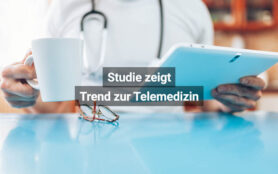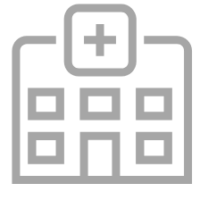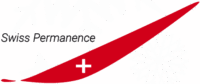Die Digitalisierung der Arztpraxen in der Schweiz stagniert weiterhin. Zwar gibt es erfreuliche Entwicklungen, etwa bei E-Rezepten oder EPD-Präferenzen, doch in vielen Praxen hängt man technisch und organisatorisch deutlich hinter dem möglichen Fortschritt zurück.
Der aktuelle Digitalisierungsstand
Laut einer Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) bleiben viele Arztpraxen in puncto Digitalisierung weit zurück. Insbesondere gegenüber Versicherungen und Pharmaunternehmen, was den digitalen Reifegrad anbelangt. Gerade die Praxen schieben auf der Skala mit durchschnittlich 3,4 von 10 Punkten das Schlusslicht, während Spitäler und Spitex-Organisationen leicht darüber rangieren.
Weitere Gründe: In vielen Praxen herrscht Unsicherheit im Umgang mit neuer Technologie, Datenschutzvorgaben werden als komplex empfunden, und Systeme sind häufig nicht kompatibel untereinander.
Warum hinken Praxen hinterher?
Ein Grund ist das Durchschnittsalter der niedergelassenen Ärzte, das im Vergleich zum Spitalsektor deutlich höher ist. Viele bleiben papierlastig, Faxgeräte sind noch üblich. Häufig kommen zudem Insellösungen zum Einsatz – verschiedene Softwarekomponenten ohne Integration –, was administrative Abläufe erschwert. Etwa die Hälfte der Praxen führt die Krankengeschichte vollständig elektronisch, doch viele arbeiten weiterhin papierorientiert.
Positive Signale – doch es braucht Strategie
Es gibt zumindest Lichtblicke: 91 Prozent der Befragten unterstützen das elektronische Patientendossier (EPD), wie die Studie zeigt. Die Akzeptanz ist also vorhanden – es fehlt an kohärenter Strategie.
Die Studie der Zürcher Hochschule empfiehlt deshalb technische Standards, internationale Schnittstellen und gezielte Innovationsförderung – auch über den E-Rezept- und EPD-Rahmen hinaus. Zudem hat der Bund im Rahmen des Programms «Digisanté» ein Massnahmenpaket beschlossen: 392 Millionen Franken sind vorgesehen, um den digitalen Rückstand bis 2034 aufzuholen.
E-Rezept und Telemedizin: praktische Digitalisierungsschritte
Ein konkretes Beispiel für Fortschritte ist das E-Rezept: Seit 2024 sind Patienten in rund 1’200 Apotheken damit versorgt – per QR-Code auf dem Smartphone oder auf Papier. Medgate hat die landesweite Einführung dieses Systems übernommen; bis 2029 soll das E-Rezept zur Norm werden. Parallel dazu arbeiten Apotheken und Ärzteverbände daran, das E-Rezept als Praxis-für-Praxislösung zu etablieren. Die Technologie dient als praktischer Digitalisierungs-Treiber.
Telemedizin bietet ebenfalls Potenzial: Über Projekte wie «Smart Managed Care» sollen Teleärzte live und datenschutzkonform auf notwendige Elemente der Krankengeschichte zugreifen können, ohne diese separat zu speichern. So bleiben die Daten in der Praxis, doch Telemedizin wird effizient nutzbar – etwa für Teilzeitmodelle oder regionale Unterversorgung.
Innovative Tools erleichtern den Alltag
Auch technische Innovationen setzen langsam ein. Generative KI-Lösungen etwa helfen, Berichte zu transkribieren, Daten zu extrahieren oder Abrechnungen zu automatisieren. KI-Assistenten können den Praxisalltag erleichtern. Weitere Angebote wie das «Health Documents»-System helfen beim rechtskonformen Digitalisieren und Archivieren von Papierunterlagen. Zentralisiert, revisionssicher und ohne Störung des Praxisbetriebs.
Fazit für die Praxisärzteschaft
Die Herausforderungen sind klar: technische Unsicherheit, Datenschutz, fehlende Systemkompatibilität, Altersstruktur der Ärzteschaft – all dies verzögert Fortschritt. Doch positive Signale existieren: E-Rezepte, Telemedizin-Projekte, KI-Tools und Bundesprogramme geben Anlass zu Zuversicht. Entscheidend ist nun eine klare, praxisnahe Strategie, die Standardisierung, Training und Unterstützung einschliesst.
Als Praxis- oder Ärzteteam empfiehlt sich ein pragmatischer Ansatz:
- E-Rezept- und EPD-Integration im eigenen Praxisverwaltungssystem prüfen
- Digitale Helfer wie KI-Transkription oder smarte Archivierung nutzen
- An regionalen Digitalisierungsinitiativen oder Verbandsprojekten beteiligen
- Auf sichere, kompatible Standards setzen und bei Bedarf gezielte Unterstützung holen
Der digitale Sprung ist machbar – wenn man ihn strukturiert angeht.