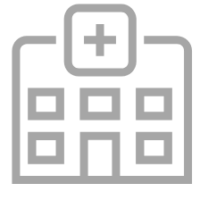Wenn Medizin heute häufiger Grenzen setzt, stellt sich eine heikle Frage umso dringlicher: Passieren diese Entscheidungen für alle Patienten gleich fair? Genau hier setzt eine aktuelle Auswertung aus der Schweiz an und bringt das Thema Ungleichheit in Spitälern erneut in den Fokus, weil sich bei Therapiebegrenzungen ein deutlicher Gender-Unterschied zeigt.
Inhaltsverzeichnis
Überblick: Ungleichheit in Spitälern
- In der Schweiz werden intensive und lebensverlängernde Massnahmen heute häufiger bewusst begrenzt als vor zehn Jahren.
- Eine grosse CHUV-Analyse (2013–2023) zeigt: Männer erhalten statistisch seltener Therapiebegrenzungen als Frauen.
- Alter (besonders >85) und schwere Komorbiditäten (u. a. metastasierender Krebs, Demenz) hängen stark mit solchen Entscheiden zusammen.
- Eine frühere Schweizer Studie zu Herzstillstand-Fällen weist ebenfalls auf Ungleichheit in Spitälern hin: Frauen landen seltener auf ICU und werden weniger intensiv behandelt.
- Beide Teams mahnen zur Vorsicht und plädieren für weitere Forschung. Trotzdem bleibt der Befund brisant.
Ungleichheit in Spitälern: Warum Therapiebegrenzungen gerade jetzt relevant werden
Die Auswertung beschreibt einen klaren Trend: Ärzte entscheiden heute häufiger als noch vor rund zehn Jahren, hochintensive Massnahmen bewusst zu begrenzen. Damit rückt das Thema Ungleichheit in Spitälern automatisch ins Zentrum, denn sobald weniger „automatisch alles“ gemacht wird, wiegen Kriterien und Entscheidungsmuster umso schwerer.
Was mit „Limitations of Therapeutic Efforts“ gemeint ist
Im Fokus stehen sogenannte „Limitations of Therapeutic Efforts“ (LTE) – also Festlegungen wie:
- Verzicht auf Wiederbelebung („Do Not Resuscitate“),
- Entscheid gegen eine Verlegung auf Intensivstation (ICU) oder Intermediate Care (IMCU),
- Übergang zu rein palliativer Behandlung.
Die CHUV-Studie: Daten, Zeitraum und zentrale Ergebnisse
Ein Team des Universitätsspitals CHUV analysierte rund 51’600 stationäre Fälle aus den Jahren 2013 bis 2023 und untersuchte, wie häufig LTE-Entscheide vorkommen und wovon sie beeinflusst werden.
Deutlicher Anstieg bei mehreren Formen der Therapiebegrenzung
Über die Jahre nahm die Häufigkeit verschiedener LTE-Anordnungen zu:
- „Do Not Resuscitate“ stieg von 47 (2013) auf 58 Prozent (2023).
- Entscheide gegen ICU-Behandlung wuchsen von 4,5 auf 31 Prozent.
- Entscheide gegen IMCU-Betreuung erhöhten sich von 0,8 auf 14,6 Prozent.
Die wichtigsten Einflussfaktoren: Alter und schwere Erkrankungen
Bei der statistischen Auswertung zeigte sich: Der stärkste Treiber für Therapiebegrenzungen war das Alter. Besonders bei sehr alten Patienten (insbesondere über 85 Jahre). Zusätzlich standen multimorbide Zustände wie metastasierender Krebs und Demenz in engem Zusammenhang mit LTE-Entscheiden.
Ungleichheit in Spitälern: Der Gender-Befund, der heraussticht
Neben Alter und Komorbiditäten fällt ein Ergebnis besonders auf: Bei Männern traten Therapiebegrenzungen statistisch signifikant seltener auf. Und zwar mit niedrigeren Odds Ratios u. a. bei „Do Not Resuscitate“, „Do Not admit to ICU“ und „Do Not admit to IMCU“.
Mögliche Erklärungen – aber bewusst vorsichtig formuliert
Die Autoren diskutieren mehrere Hypothesen und markieren sie ausdrücklich als Deutungsansätze: Denkbar seien kulturelle Muster (Therapiebegrenzung als „Schwäche“), unterschiedliche Präferenzen (Patientinnen eher palliativ orientiert) oder auch, dass Ärzte – bewusst oder unbewusst – Frauen weniger invasive Optionen anbieten. Gleichzeitig betonen sie, dass dafür weitere Forschung nötig ist.
Zweite Studie: Ungleichheit in Spitälern auch nach Herzstillstand sichtbar?
In einer früheren Schweizer Analyse zu Patienten nach Herzstillstand wurden geschlechtsspezifische Unterschiede bei ICU-Versorgung und Outcomes beschrieben.
Was die Basler Auswertung berichtet
Die Studie fand Unterschiede bei zentralen Kennzahlen – unter anderem:
- Frauen wurden seltener auf die Intensivstation aufgenommen.
- Nach der Wiederbelebung waren die Behandlungsmassnahmen weniger umfassend.
- ICU-Aufenthalte von Frauen waren kürzer als jene von Männern.
Warum die Interpretation trotzdem kompliziert bleibt
Auch dieses Team ordnet ein: Die Patientinnen waren tendenziell älter und hatten mehr Komorbiditäten, was sowohl Sterblichkeit als auch Therapieentscheidungen mit erklären könnte. Dennoch bleibt als kritischer Punkt bestehen, dass bei Frauen häufiger frühzeitig auf lebenserhaltende Massnahmen verzichtet wurde. Ein Befund, der die Diskussion über Ungleichheit in Spitälern weiter anheizt.
Fazit
Beide Studien zeichnen ein Bild, das mindestens zwei Dinge gleichzeitig fordert: methodische Vorsicht – und inhaltliche Wachsamkeit. Denn auch wenn Alter und Krankheitslast vieles erklären können, bleibt die wiederkehrende Richtung auffällig: Frauen scheinen in kritischen Situationen eher von intensiven Massnahmen ausgeschlossen zu sein. Genau deshalb wird Ungleichheit in Spitälern zur Frage, wie Entscheidungen dokumentiert, diskutiert und überprüft werden sollten.
Häufige Fragen
- Was bedeutet Ungleichheit in Spitälern in diesem Kontext?
- Welche Hinweise auf Ungleichheit in Spitälern liefert die CHUV-Studie?
- Warum ist Ungleichheit in Spitälern schwer eindeutig zu beweisen?
- Was folgt aus den Ergebnissen für den Umgang mit Ungleichheit in Spitälern?
Ungleichheit in Spitälern meint hier, dass Patienten je nach Geschlecht statistisch unterschiedlich häufig intensive oder lebensverlängernde Massnahmen erhalten bzw. dass Therapiebegrenzungen unterschiedlich oft entschieden werden.
Die CHUV-Auswertung zeigt Ungleichheit in Spitälern, weil Männer in den Daten seltener Therapiebegrenzungen (z. B. DNR oder kein ICU/IMCU) aufweisen als Frauen. Trotz gleichzeitiger Berücksichtigung mehrerer Faktoren in der Analyse.
Ungleichheit in Spitälern ist schwer eindeutig zuzuordnen, weil Alter und Komorbiditäten stark hineinspielen: In der Herzstillstand-Analyse waren Frauen tendenziell älter und kränker, was Therapieentscheidungen mit beeinflussen kann.
Aus Sicht der Studien und der Berichterstattung legt Ungleichheit in Spitälern nahe, Entscheidungsprozesse und Versorgungspfade kritisch zu hinterfragen und mit weiterer Forschung besser zu klären, ob Präferenzen, Kultur oder Bias eine Rolle spielen.