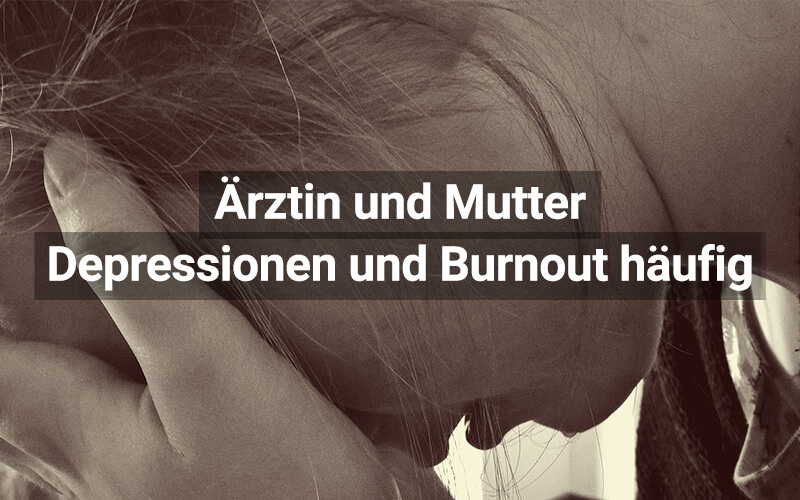
Mutter und Ärztin: Psychologische Betreuung notwendig
Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen – dieses Problem kennen viele berufstätige Frauen. Auch für Ärztinnen bedeutet die Doppelbelastung aus Kinderbetreuung und Praxis- oder Krankenhaustätigkeit eine besondere Herausforderung. Nicht selten mündet sie in psychische Erkrankungen – “wenn alles zu viel wird” –, dann kann psychologische Betreuung notwendig sein.
Dass junge Frauen nach jahrelangem Medizin-Studium und anstrengender Ausbildung das Bedürfnis haben, beruflich durchzustarten, ist nur allzu verständlich. Gleichzeitig soll häufig der Wunsch nach Familie und Kindern nicht zu kurz kommen. Dabei tickt die biologische Uhr – Schwangerschaft lässt sich nicht unbegrenzt aufschieben. Von daher ergibt sich nahezu zwangsläufig die Situation, dass Beruf und Kinder parallel zu bewältigen sind.
Rund 30 % haben psychische Probleme
Auch im Zeitalter der Emanzipation und Gleichberechtigung bleibt die sich daraus ergebende Doppelbelastung überwiegend an den Frauen hängen. In einer aktuellen Untersuchung des Deutschen Gewerkschaftsbundes gaben 31 Prozent der befragten vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen an, dass sie sehr häufig Schwierigkeiten hätten, Kinderbetreuung und Arbeit zeitlich zu vereinbaren. Bei den befragten Männern waren es nur 26 Prozent. Für Ärztinnen dürften diese Schwierigkeiten in besonderem Masse zutreffen, denn der Arztberuf stellt meist überdurchschnittliche zeitliche Anforderungen.
Arbeitszeit nicht alleine schuld
Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die reine Arbeitszeit, sondern auch bezüglich der zeitlichen Struktur und der Planbarkeit von Arbeit. Ein geregelter Acht-Stunden-Tag ist für vollzeitbeschäftigte Ärztinnen wohl eher Utopie als Realität. Überstunden gehören im Krankenhaus zur Normalität, stets muss damit gerechnet werden, dass wegen Notfällen oder akutem Behandlungsbedarf die Zeitplanung aus den Fugen gerät. Der Bereitschaftsdienst mit 24 Stunden-Schichten und mehr ist eine besondere Herausforderung. Aber auch frei praktizierende Ärztinnen vermögen ihre Arbeitszeit nur bedingt selbst steuern. Patienten, die Hilfe benötigen, können nicht einfach abgewiesen werden. Selbst Teilzeit-Modelle bieten nicht zwangsläufig eine Entlastung. Oft bedeutet sie nur anteilige Bezahlung, die Arbeitszeit reduziert sich nicht entsprechend. Besonders stressig sind stets unerwartete Ereignisse, ob zu Hause oder im Beruf, für die Ad-hoc-Lösungen gefunden werden müsse.
Es geht aber nicht nur um zeitliche Probleme. Sowohl die Arzttätigkeit als auch Kinderbetreuung und -erziehung sind verantwortungsvolle Aufgaben, die vollen Einsatz erfordern – physisch und psychisch. Routine gibt es zwar auch, doch in beiden Feldern sind vielfach aussergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Es ist wenig überraschend, dass dies schnell zur Überforderung führen kann. Wird dies zum Dauerzustand, sind psychische Probleme fast unausweichlich.
Wenn Doppelbelastung zu Depressionen und Burn-out führt
Laut Angaben eines Unterstützungswerks für Schweizer Ärztinnen und Ärzte gehört die Doppelbelastung als Mutter und Ärztin zu den wichtigsten Ursachen für psychische Erkrankungen bei Medizinerinnen. Am Sorgentelefon der Einrichtung meldeten sich im vergangenen Jahr zu 70 Prozent Frauen, nur 30 Prozent waren Männer. Das spricht für sich. Belastung am Arbeitsplatz, Burn-Out und Depressionen waren die häufigsten Nennungen.
Vielleicht erwartet mancher, dass Ärztinnen in der Lage sein sollten, solche Krisen selbst zu bewältigen, sich also quasi selbst zu therapieren – schliesslich sind psychologische Kenntnisse Teil des Medizinstudiums. Die Erfahrung zeigt, dass dies nicht so ist. Selbst langjährig erfahrene Psychiater oder Psychologen sind nicht davor gefeit, selbst behandlungsbedürftig zu werden. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob man persönlich von einem Problem betroffen ist oder es von aussen sieht und analysiert.
Entlastung durch psychologische Behandlung
Wer als Ärztin das Gefühl hat, dass Beruf und Familie “über den Kopf wachsen” und keinen Ausweg mehr weiss, sollte sich daher nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine fundierte psychologische Betreuung eröffnet Chancen, wieder Grund und Boden zu finden und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Oft bedeutet bereits das psychologische Gespräch eine heilende Entlastung, noch besser ist, wenn die darin entwickelten Lösungsansätze in die Tat umgesetzt werden. Ggf. empfiehlt sich auch ein stationärer Aufenthalt. Er kann eine notwendige und wertvolle Auszeit sein, um wieder zu sich selbst zu finden und die täglichen Herausforderungen mit neuer Kraft anzugehen.







